Benutzer:Herr Giesinger/Artikelentwurf

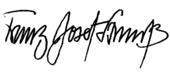
Franz Josef Strauß (* 6. September 1915 in München; † 3. Oktober 1988 in Regensburg) war ein deutscher Politiker der CSU, deren Vorsitzender er von 1961 bis zu seinem Tod war.
Strauß gehörte der Bundesregierung als Bundesminister für besondere Aufgaben (1953–1955), Bundesminister für Atomfragen (1955–1956), Bundesminister der Verteidigung (1956–1962) und Bundesminister der Finanzen (1966–1969) an. Von 1978 bis 1988 war er Bayerischer Ministerpräsident, scheiterte bei der Bundestagswahl 1980 aber als Kanzlerkandidat der Unionsparteien[1] gegen den amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD). Strauß unterhielt enge Verbindungen zur Industrie und gehörte zu den Hauptinitiatoren bei der Gründung des Unternehmens Airbus.
Herkunft und Ausbildung 1915–1939[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Franz Josef Strauß war das zweite Kind des Metzgers Franz Josef Strauß (1875–1949) und dessen Frau Walburga[2] (1877–1962). Sein Vater stammte aus Kemmathen[2] (heute zu Arberg/Mittelfranken), die Mutter aus Unterwendling (heute zu Kelheim/Niederbayern). Sein Geburtshaus war in der Schellingstraße 49 (heute Hausnummer 47) im Münchener Stadtteil Maxvorstadt, wo die Familie seit 1904 wohnte. Der Vater betrieb dort eine Metzgerei. Die Familie Strauß war streng katholisch, monarchistisch und antipreußisch eingestellt. Franz Josef Strauß sen. war langjähriges Mitglied der Bayerischen Volkspartei. Die Familie befürwortete die Trennung Bayerns vom Deutschen Reich, wie sie zeitweise auch die Bayerische Volkspartei forderte.[3]
Sechs Tage nach seiner Geburt wurde er als Franz Joseph Strauß in das Geburtenregister eingetragen und am 12. Oktober 1915 in der Ludwigskirche getauft. Während seiner Kindheit, als Student und während der Militärzeit wurde er nur bei seinem ersten Vornamen „Franz“ gerufen. Erst nach dem Tod seines Vaters nutzte er allmählich beide Vornamen.[4] Auf Rat eines Benediktinerpaters wechselte Strauß von der Volksschule an der Amalienstraße auf die Gisela-Realschule. Der Universitätsprofessor Johannes Zellinger sorgte dafür, dass er später auf das humanistische Maximiliansgymnasium wechselte.[5]
Nachdem er im März 1935 am Maximiliansgymnasium in München das bayernweit beste Abitur seit 1910 abgelegt hatte, konnte Strauß als Stipendiat der Stiftung Maximilianeum ein Lehramtsstudium der Altphilologie, Geschichte, Staatswissenschaften und Germanistik an der Universität München beginnen. Dieses Studium schloss er im Jahr 1940 während verschiedener Fronturlaube mit dem ersten Staatsexamen für das höhere Lehramt ab. Es folgten das zweite Staatsexamen im Jahr 1942 und die Studienratsprüfung 1943[6]. Zuvor war seine Immatrikulation abgelehnt worden, weil er keiner nationalsozialistischen Organisation angehörte, aufgrund der Beschwerde seines ehemaligen Tutors und Lehrers wurde er aber dann doch zugelassen.[3] Später trat er der katholischen Münchner Studentenverbindung Tuiskonia bei. Strauß war später Mitglied des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbunds (NSDStB).[7] In seiner Freizeit ging Strauß dem Radsport nach und wurde 1937 auf Anraten des Professors Franz Dirlmeier Mitglied des Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps (NSKK) sowie Referent beim NSKK-Sturm 23/M 86 in München.[8] Er hatte dort die Funktion eines Rottenführers inne.[9] Im Juli 1939 trat er aus dem NSKK aus. Diese Mitgliedschaft wurde von der Spruchkammer in Schongau zwar als belastend eingestuft, jedoch gleichzeitig „[…] als zwangsbedingt, um eine Nichtzulassung zum Examen zu vermeiden.“ Sie wurde als nominelle Mitgliedschaft gewertet, die weder propagandistisch noch aktiv ausgeübt wurde.[10]
Kriegsjahre 1939–1945[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zunächst wurde er aufgrund seines Studiums zweimal zurückgestellt und am 31. August 1939 von der Wehrmacht nach Landsberg am Lech eingezogen. Später wurde er zur II. Abteilung des Artillerieregiments 43 in der Nähe von Trier versetzt. Im März 1940 wurde er beurlaubt, um das Erste Staatsexamen abzulegen, zurück zur Truppe wurde seine Einheit am 1. Mai zum Westfeldzug nach Frankreich verlegt. Nach dem Waffenstillstand am 25. Juni gehörte Strauß zu den Besatzungstruppen und war zunächst an der Kanalküste, später in Belgien stationiert. Zum 1. November wurde er zum Unteroffizier befördert und gleichzeitig erneut beurlaubt.[11]
Am Theresien-Gymnasium München konnte er durch ein verkürztes Referendariat sein Studium fortsetzen und am 1. April 1941 mit dem Zweiten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien beenden. Parallel zum schulischen Referendariat war Strauß Assistent am Altphilologischen und am Althistorischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig.
Am 14. April 1941 wurde er erneut zur Wehrmacht einberufen und nahm ab dem 22. Juni 1941 am Krieg gegen die Sowjetunion teil. Am 30. Juni war er in Lemberg Zeuge, als die Deutschen zahlreiche Leichen vom sowjetischen Geheimdienst NKWD ermordeter Gefangener auffanden. Strauß schrieb später in seinen Lebenserinnerungen, er sei als Wehrmachtssoldat mehrfach Zeuge von deutschen Massakern an Juden im Osten geworden.[12] Diese Kriegserlebnisse hätten ihn nach eigener Aussage tief geprägt. Von September 1941 bis Februar 1942 nahm er am Offiziersausbildungskurs teil und wurde im März 1942 als Leutnant d. R. der Heeresflak zugeteilt und in der Ukraine, auf der Krim sowie vor Stalingrad eingesetzt. Dort erlitt er Erfrierungen an beiden Füßen, weshalb er noch vor dem Untergang der 6. Armee in der Schlacht von Stalingrad ins Reich zurückverlegt wurde. Nach einem weiteren Lehrgang von Januar und Mai 1943 in Stolpmünde wurde er Ausbildungsoffizier und Abteilungsadjudant in Altenstadt bei Schongau.
Schon während der Militärzeit wurde er am 8. April 1942 mit Wirkung zum 1. Mai zum außerplanmäßigen Beamten ernannt. Am 20. April 1943 erfolgte die Ernennung zum Studienrat an der Oberschule für Jungen an der Damenstiftstraße in München. Notizen zu einer von ihm begonnenen Dissertation verbrannten 1944.
Nachdem er am 1. Juni 1944 zum Oberleutnant befördert worden war, wurde er im selben Jahr Chef der Stabsbatterie an der Flak-Artillerie-Schule IV in Altenstadt.[13] Seine Nachfolge in dieser Funktion trat Mitte April 1945 der Schriftsteller Hans Hellmut Kirst an. Strauß bezichtigte Kirst 1945 bei der US-amerikanischen Besatzungsmacht, Anhänger des Nationalsozialismus gewesen zu sein. Kirst verbrachte neun Monate in einem US-Internierungslager in Garmisch. Obwohl Kirst als politisch ‚unbelastet‘ entlassen wurde, verhängte Strauß als Landrat und Vorsitzender der Spruchkammer ein zweijähriges Schreibverbot gegen ihn. In dieser Zeit begannen die jahrelang erbittert geführten Auseinandersetzungen zwischen den beiden.[14]
Politische Karriere[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nachkriegszeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei Kriegsende geriet Strauß zunächst in Kriegsgefangenschaft; er wurde schnell (noch 1945) als politisch unbelastet eingestuft. Ein deutschstämmiger US-Soldat zog ihn aufgrund seiner Englischkenntnisse zur Unterstützung bei Übersetzungen heran. Von der amerikanischen Besatzungsmacht wurde er dann zum stellvertretenden Landrat des Landkreises Schongau bestellt.[15]
1946 war er Mitbegründer des Kreisverbandes der CSU Schongau und wurde zum Landrat von Schongau gewählt. Seit 1948 war Strauß Mitglied im Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in Frankfurt am Main; 1949 wurde er von Hans Ehard zum ersten Generalsekretär der CSU ernannt.
Strauß suchte neben seiner Parteikarriere auch Führungsaufgaben in der überparteilichen Europa-Union Deutschland (EUD). Er unterlag am 2. Mai 1954 dem CDU-Bundestagsabgeordneten Paul Leverkuehn (1893–1960) in einer Kampfabstimmung zur Wahl des EUD-Präsidenten.
- ↑ Saskia Richter: Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß, 1980. In: Historisches Lexikon Bayerns. 19. Juni 2017, abgerufen am 10. März 2018.
- ↑ a b Schuler: Strauß. Die Biografie einer Familie. Frankfurt am Main 2006, S. 19.
- ↑ a b Werner Biermann: Strauß. Aufstieg und Fall einer Familie. Rowohlt, Berlin 2006.
- ↑ Hat sich Franz Josef Strauß aus politischen Gründen später einen zweiten Vornamen zugelegt? Hanns-Seidel-Stiftung e. V., abgerufen am 1. September 2012.
- ↑ KulturGeschichtsPfad – Stadtbezirk 3: Maxvorstadt (PDF); Broschüre der Landeshauptstadt München, Seite 60
- ↑ Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Gerade auf LeMO gesehen: LeMO Franz Josef Strauß. Abgerufen am 12. April 2017.
- ↑ „Die Sauhund’ hau’n wir wieder ’naus“. In: Der Spiegel. Nr. 48, 1980, S. 108–126 (online).
- ↑ Darüber berichtet Strauß selbst in seinen Erinnerungen. Berlin 1980, S. 35–37.
- ↑ STRAUSS: Einer der Schärfsten. In: Der Spiegel. Nr. 23, 1981, S. 98–99 (online).
- ↑ Ist Franz Josef Strauß Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen gewesen? Hanns-Seidel-Stiftung e. V., abgerufen am 1. September 2012.
- ↑ Soweit nicht anders angegeben, stammen die Daten zur Militärzeit und dem parallelen Studium aus: fjs.de: Ausbildung und fjs.de: Soldat
- ↑ Peter Lieb: Verbrechen der Wehrmacht – Was konnten Wehrmachtsoldaten von den NS-Verbrechen hinter der Front wissen? Tagebuch eines Täters gazette.de
- ↑ Franz Josef Strauß: Ich bekenne mich: Die Erinnerungen des Franz Josef Strauß (II): Der Weg zum Politiker. In: Der Spiegel. Nr. 36, 1989 (online).
- ↑ Auf höherer Ebene. In: Der Spiegel. Nr. 21, 1954 (online).
- ↑ Strauss, Franz Josef – Federal Republic of Germany – Minister of Defense. Central Intelligence Agency, Juli 1961, archiviert vom am 17. Mai 2012; abgerufen am 17. April 2010.